Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Ossifikation – die Knochenbildung einfach erklärt
Was ist Ossifikation?
Ossifikation bezeichnet den Prozess der Knochenneubildung. Die Neubildung von Knochengewebe erfolgt zum einen während der Entwicklung und des Wachstums, zum anderen zur Regeneration, zum Beispiel nach einer Fraktur. Auch bei bestimmten Krankheiten kann Ossifikation auftreten. Ein Knochenwachstum ist sowohl in die Länge als auch in die Breite möglich. Knochengewebe erneuert sich während des Erwachsenenalters kontinuierlich. Die Neubildung und der Umbau von Knochengewebe erfolgen durch die Aktivität spezialisierter Zellen.
Welche Arten der Knochenbildung gibt es?
Je nach Entstehungsprozess und Ausgangsgewebe unterscheidet man die Ossifikation in zwei Formen:
- desmale Ossifikation
- chondrale Ossifikation
„Desmal“ kommt von dem griechischen Begriff „desmos“ (Verbindung) und bedeutet „bindegewebig“. Die desmale Ossifikation wird auch als direkte Ossifikation bezeichnet. Hierbei erfolgt die Knochenneubildung aus dem Bindegewebe. Embryonales Bindegewebe, das Mesenchym, wird zu Knochen umgebaut. Die so entstandenen Knochen werden als Deck- oder Belegknochen bezeichnet. Beispiele für Knochen aus desmaler Ossifikation sind die Schädelknochen oder die Schlüsselbeine. „Chondral“ bedeutet „den Knorpel betreffend“ (griechisch: „chondros“, Knorpel). Bei der chondralen Ossifikation entsteht der Knochen über das Knorpelgewebe. Die Form der Ossifikation wird auch als indirekte Osteogenese bezeichnet, da aus dem Mesenchym zunächst Knorpel entsteht. Der vorhandenen Knorpel unterliegt dann einer Verknöcherung. Die chondrale Verknöcherung wird zudem in die perichondrale und die enchondrale Ossifikation unterteilt. Bei der perichondralen Knochenbildung erfolgt die Knochenbildung von der Diaphyse (Knochenschaft) aus. Von aussen nach innen bildet sich neues Knochengewebe. Die enchondrale Ossifikation erfolgt von innen nach aussen. Dies geschieht zum Beispiel in den Epiphysenfugen (Wachstumszone noch in der Entwicklung befindlicher Knochen).
Wie läuft die Entwicklung von Knochengewebe ab?
Für die Entstehung von Knochen wandelt sich embryonales Bindegewebe in eine Knorpelmatrix oder direkt in Knochen um. Punkte, an denen die Verknöcherung in Gang gesetzt wird, heissen Ossifikationszentren. Je nach Ossifikationsform sind verschiedene Arten von Zellen an der Verknöcherung beteiligt. Mesenchymzellen sind die Ausgangszellen, aus denen sich solche Zellen differenzieren. Pluripotente Mesenchymzellen bilden ausserdem das Knochenmark. Unter anderem folgende Zellen können an der Ossifikation beteiligt sein:
- Chondroklasten
- Osteoblasten
- Osteozyten
- Osteoklasten
Während bei der desmalen Ossifikation der Knochen direkt von Osteoblasten erzeugt wird, muss bei der chondralen Ossifikation zunächst Knorpel abgebaut werden. Dies passiert durch die Chondroklasten. Gleichzeitig bilden Osteoblasten neue Knochensubstanz. Bei der enchondralen Ossifikation kommt es durch die kontinuierlichen Auf- und Abbauprozesse innerhalb der Epiphysenfugen zum Längenwachstum des Knochens. Für die perichondrale Ossifikation bilden Osteoblasten eine Knochenmanschette um das Knorpelmodell der Diaphyse entlang. Es kommt zum appositionellen Wachstum: Der Knochen nimmt an Dicke zu. Osteozyten oder Osteoklasten sind beteiligt, wenn Knochensubstanz um- beziehungsweise abgebaut werden muss.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
Nürensdorf
Praxis Valeo
Bezahltes RankingBaltenswilerstrasse 2, 8309 Nürensdorf0 Bewetungen0448... Nummer anzeigen 044 836 44 18 *CHF/h 180.- -
Zürich
Enzler Béatrice
Bezahltes RankingTorgasse 6, 8001 Zürich0 Bewetungen0432... Nummer anzeigen 043 268 47 77 * -
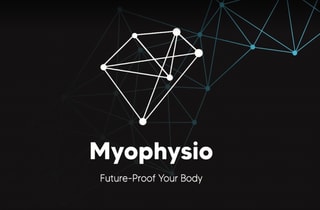 Buchs
BuchsMyophysio
Im Hag 11, 5033 BuchsMyophysio wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet513 Bewetungen0766... Nummer anzeigen 076 667 88 57 *CHF/h 140.-
Was sind Osteoblasten?
Osteoblasten differenzieren sich aus den Mesenchymzellen. Als spezialisierte Zellen produzieren Osteoblasten die Knochengrundsubstanz, das Osteoid. Dieses wird im Anschluss mineralisiert, was die Verknöcherung bewirkt. Durch die kontinuierliche Bildung neuer Knochensubstanz mauern sich die Osteoblasten selbst ein. Aus ihnen werden schliesslich die Osteozyten – ruhende Zellen, die Belastungen des Knochens registrieren und zum Knochenumbau und zur Knochenerneuerung beitragen.
Wie unterstützen Muskeln die Osteogenese?
Bei der Neubildung von Knochen entsteht zunächst der Geflecht- oder Faserknochen. Dabei handelt es sich um eine ungeordnete Ansammlung von Kollagenfibrillen. Diesen Knochen mangelt es noch an Festigkeit. Durch zunehmende Beanspruchungen, wie Druck- und Zugbelastungen, an denen auch die Muskeln beteiligt sind, kommt es zu der Bildung des festeren Lamellenknochens. Auf der anderen Seite können Überbeanspruchungen der Muskulatur (zum Beispiel durch Leistungssport) oder Gewebetraumata nach Unfällen oder Operationen zu Verknöcherungen ausserhalb des Skeletts führen. Dies wird als heterotrope Ossifikation bezeichnet. Passieren solche Verknöcherungen im Bereich der Gelenke, kann dies zu starken Bewegungseinschränkungen führen.
Was beeinflusst die Ossifikation?
Knochen befinden sich im ständigen Umbau. Abbau- und Aufbauprozesse finden kontinuierlich statt. Knochen bestehen zu einem Drittel aus Knochengrundsubstanz und zu zwei Dritteln aus Mineralsalzen. Der wichtigste Mineralstoff für den Knochen ist das Kalzium. Kalzium muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Dabei spielt Vitamin D eine wichtige Rolle. Bei Kalziummangel werden Osteoklasten aktiv, die den Knochen abbauen und Kalzium mobilisieren. Dieser Vorgang wird durch die Nebenschilddrüse und das Parathormon reguliert. Gegenspieler ist das Calcitonin aus der Schilddrüse, das die Osteoklasten hemmt. Auch die Sexualhormone Östrogen und Testosteron beeinflussen den Knochenstoffwechsel. Störungen in diesen Hormonregelkreisen nehmen Einfluss auf die Knochendichte.
Was kann Bewegung für die Knochen tun?
Regelmässige Bewegung steigert die Knochendichte. Auch wer unter Osteoporose (Verminderung der Knochendichte) leidet, kann mit gut dosierter Bewegung der Erkrankung entgegenwirken und die Gefahr für Knochenbrüche reduzieren. Dabei sollte eine Art von Bewegung gewählt werden, die den Knochenstoffwechsel anregt, neuen Knochen aufzubauen. Krafttraining eignet sich besonders gut, da sich Zug- und Druckbelastungen kontinuierlich abwechseln. Um gleichzeitig die Koordination und das Gleichgewicht zu schulen, sind Sportarten wie Tanzen oder Tai-Chi empfehlenswert.
Der Osteopathievergleich für die Schweiz. Finde die besten Osteopathen in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Osteopathen
Das könnte dich auch interessieren
Chiropraktiker Krankenkasse: Wichtige Infos zu den gesetzlichen Leistungen
Wenn der Rücken schmerzt, immer wieder Kopfschmerzen auftreten oder der Nacken ständig verspannt ist, kann ein Chiropraktiker der richtige Ansprechpartner sein. Wer aber trägt die Kosten für die meist aufwändige Therapie? Versicherte in der Schweiz müssen sich keine Sorgen machen, da die Chirotherapie über die Grundversicherung abgedeckt ist. Welche Leistungen die Grundversicherung übernimmt und wo ihre Grenzen sind, erfährst du in unserem Ratgeber. Wir erklären dir zudem, wann du eine Überweisung deines Hausarztes für den Chiropraktiker brauchst und warum sich ein Krankenkassenwechsel lohnen kann.
Die osteopathische Behandlung – Nutzen und Anwendungsbereiche
Alternative Heilmethoden werden immer stärker nachgefragt und ermöglichen oftmals eine schonende Behandlung von Beschwerden, Schmerzen und Krankheiten. Dazu gehört die Osteopathie, eine Behandlungsmethode, die die Hände benutzt, um die Harmonie störenden Blockaden im Körper zu lösen. Diese sind die Ursache für viele Beschwerden. Die osteopathische Behandlung überzeugt als sanftes Verfahren und eignet sich daher für alle, von Kleinkindern bis zu älteren Menschen.
Osteopathie Anwendungsgebiete – systemische Behandlung des gesamten Körpers
Osteopathische Anwendungsgebiete umfassen Beschwerden psychischer und physischer Natur. Heilpraktiker und Mediziner bieten osteopathische Behandlungen bei verschiedenen Krankheiten an. Dabei wird der Patient in seiner Gesamtheit gesehen. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht es, bereits bei der Diagnose systemische Zusammenhänge zu erfassen und in den Behandlungsplan einzubeziehen. Osteopathie eignet sich für Kinder und Erwachsene, die mit Kopf- und Rückenschmerzen, emotionalen Herausforderungen, Verdauungsproblemen, Verspannungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats zu kämpfen haben. Die schmerzlose Behandlungsform löst Blockaden und führt zu einer deutlichen Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens. Daher werden osteopathische Techniken auch begleitend zu schulmedizinischen Verordnungen genutzt.
Lumbalgie: Symptome, Ursachen und Behandlung der Kreuzschmerzen
Die Lumbalgie zählt zu den häufigsten Rückenerkrankungen überhaupt. Meist handelt es sich um chronische Schmerzzustände, die den Bereich des unteren Rückens betreffen. Menschen jeden Alters können von Schmerzen in der Lendenwirbelsäule betroffen sein, wobei die Ursachen vielfältig sind. Es kann sich dabei um chronische oder um akute Schmerzen handeln. Die akute Lumbalgie wird meist durch eine falsche Bewegung ausgelöst. Im Volksmund spricht man auch von einem Hexenschuss. Welche Therapie gewählt wird, hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab.
Kalkschulter: Häufige Ursache von Schulterschmerzen
Oft beginnt der Prozess schleichend: Du hast Schmerzen beim Heben des Arms oder Drehbewegungen werden unangenehm, aber du kannst das noch ignorieren. Schliesslich gibt es Schlimmeres als ein leichtes Ziehen im Bereich der Schultern. Doch spätestens, wenn du nicht mehr auf einer Seite liegen kannst, weil dich Dauerschmerzen plagen, werden Schulterschmerzen wirklich quälend. Die Ursache für die Symptome ist häufig eine sogenannte „Kalkschulter“. Wie erkennt man diese Erkrankung, welche Ursachen gibt es und vor allem: Was hilft bei einer Kalkschulter? Die gute Nachricht zuerst: Es gibt wirksame Therapien und manchmal verschwinden die Beschwerden auch ganz von alleine.
Leistenschmerzen – alles rund um die lästigen Beschwerden
Leistenschmerzen sind nicht nur sehr unangenehm, sondern können auch auf ernsthafte Ursachen zurückzuführen sein. Damit sich die Schmerzen nicht zu einem chronischen Problem entwickeln, sind eine schnelle Diagnosestellung und eine anschliessende Behandlung oft unerlässlich. Welche Gründe Leistenschmerzen haben können, wie sich die Symptome äussern und was du zur Vorbeugung tun kannst, erfährst du in diesem FAQ.

